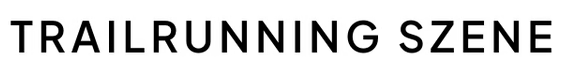Meine Erfahrung beim Swiss Peaks 700
Ich teile diese Geschichte, obwohl ich beim Swiss Peaks 700 nicht ins Ziel gekommen bin, obwohl ich sie nach wie vor nicht besonders rühmlich finde. Ausstieg nach 150 Kilometern und nicht das, worauf ich so lange hingearbeitet hatte. Für mich war die Erfahrung trotzdem unglaublich wertvoll. Ich hatte den Mut zu starten, ich habe es versucht und genau das zählt für mich auch im Nachhinein.
Es war emotional, intensiv und extrem schwierig. Aber genau das ist es, was Ultralaufen ausmacht. Wir lernen eben nicht nur von Erfolgen, sondern vor allem von Rückschlägen – und genau von diesen leider am meisten.
Wenn ich über das Rennen berichte, dann hoffe ich, dass sich einige ein paar Dinge davon mitnehmen können, für das nächste Rennen, das bevorsteht oder auch das nächste große persönliche Projekt. Egal ob es um den Laufsport geht, um das Leben im Allgemeinen: Vielleicht helfen meine Fehler und Erkenntnisse dem einen oder anderen. Vielleicht ist es auch ein ‚Reminder‘, dass es sich immer lohnt wieder aufzustehen und es noch einmal zu versuchen.
Warum 700 Kilometer?
Vor dem SwissPeaks war mein längstes bisheriges Rennen der Tor des Géants mit 350 Kilometern und etwa 30.000 Höhenmetern im italienischen Aostatal. Schon dort ging es mir nie um Zeiten oder Platzierungen. Mich interessiert in der Regel eine ganz andere Frage: Was passiert mit mir, wenn ich weitergehe als ’normal‘? Wie werde ich mich auf dieser Reise verändern, welche Seiten in mir werde ich entdecken?
Speziell die Nächte haben einen besonderen Zauber und Faszination. Nachts alleine unterwegs sein, unter den Sternen, ist eine ganz besondere Erfahrung – immer wieder. Das ist es, was mich an diesen Rennen (wenn man das überhaupt so bezeichnen möchte) anzieht. Marathons und dergleichen reizen mich nicht wirklich. Die Jagd nach Sekunden ist höchstens eine Bestätigung für mein Ego, aber eigentlich fühlt es sich bedeutungslos an. Ich möchte mich persönlich weiter entwickeln. Ultralauf ist für mich der Weg, den ich dafür am liebsten gehe.
Der SwissPeaks 700 war eines der größten Ziele, das ich mir je gesetzt habe:
700 Kilometer. 49.000 Höhenmeter. Alleine. Maximal zehn Tage.
Der Start – zwischen Ruhe und Sturm
Etwa eine Woche vor dem Start wurden Anspannung und Nervosität immer größer. Daheim hatte ich noch eine Unmenge zu tun, die To-Do Liste wurde nicht kürzer. Ich wollte mich eigentlich akribisch vorbereiten, Zeitlimits studieren, Höhenprofile, meine Ausrüstung gründlich sortieren. Aber die Tage vergingen schneller und schneller und der Tag X rückte immer näher.
Zeit Tage vor dem Start hatte ich es geschafft. Zwei große Taschen, zwei Rucksäcke mit insgesamt sicher 20 Kilo Gewicht, die ich erst einmal zum Bahnhof schleppen musste – durchgeschwitzt bereits vor der Reise, aber Hauptsache der Zug war erwischt. Die Reise in die Schweiz begann endlich, an der Grenze holte mich meine Freundin ab. Sie endlich zu sehen war eine Erleichterung – endlich war ich mit den vielen Gedanken nicht mehr alleine.
Die letzte Nacht vor dem Start verbrachten wir auf einem Campingplatz am Genfer See. Die Atmosphäre war ruhig und entspannt: Sonnenschein, ein einfaches Frühstück, kochen, Sandwiches vorbereiten und ein letzter Check meines Laufrucksacks. Die Ruhe vor dem Sturm.
Am Nachmittag machten wir uns langsam auf den Weg in den Startbereich. Bei so einem Event die Startnummer abzuholen ist ein ganz besonderer Moment – plötzlich wird alles real. Das Abendessen danach: Simpel. Reis und Eier. Der Startschuss sollte um 8 Uhr am Abend fallen. Etwa 100 Läufer und ich. Die Sonne ging unter, der Himmel strahlte und ich fühlte mich unendlich dankbar. Monate der Vorbereitung, unzählige Läufe am frühen Morgen und jede Menge Trainingsläufe in meinem Leben führten exakt hierher.
Jetzt war es an der Zeit herauszufinden, was ich in mir hatte. Ich war nervös und glücklich. Vor allem aber so richtig am Leben.

Erste Nacht – erster Fehler
Der Anfang war gut. Wir verließen den Startort, die Sonne ging unter und der erste Uphill wartete auf uns. Bei so einem Rennen auf andere zu schauen, macht überhaupt keinen Sinn. Ich versuchte meinen Rhythmus zu finden und wirklich bei mir zu sein.
Es war dunkel, es war still. Ein Schritt nach dem anderen. Nach etwa 20 Kilometern machte ich aber meinen ersten Fehler. Von anderen Rennen war ich es gewohnt, dass eingezeichnete Wasserstellen betreut wurden. Hier war es nicht so. Deshalb lief ich weiter und weiter, unter anderem auch an einem kleinen Brunnen vorbei (den ich aber nicht bemerkt hatte). Plötzlich war die Ortschaft aber hinter mir, die Kilometer auf meiner Uhr zu hoch und ich hatte kein Wasser; mit einem Anstieg von über 1.000 Höhenmetern vor mir.
Was also tun? Ohne Wasser würde ich nun ein riesen Problem bekommen. Wo war der nächste Bach, die nächste Quelle? Ich wollt mir absolut sicher sein, dass irgendwo darüber Kühe oder Schafe weiden würden. Nur kein Risiko eingehen. Nach einiger Zeit kamen wir zu einem Bach, der meine ‚interne Prüfung‘ bestand. Keine Tiere in Sicht, ein sehr schnelles Gewässer, viele Steine, sehr klar. Zwei weitere Läufer füllten hier ebenfalls ihre Vorräte auf. Mir blieb ohnehin nichts anderes übrig als dieses Restrisiko einzugehen, aber das würde mir ganz sicher nicht mehr passieren.
Trotz dieser Unsicherheit war die erste Nacht magisch. Das Wetter hätte nicht besser sein können, es war sternenklar und das einzige Licht kam von einigen wenigen Stirnlampen in der Ferne.
Der Sonnenaufgang über dem Genfer See war atemberaubend und mit Sicherheit einer der schönsten Momente draußen in der Natur, die ich je erlebt habe.
Die Abstiege jedoch waren brutal. Steiler und steiler, so etwas hatte ich ebenfalls noch nie erlebt. Trotzdem fühlte ich mich stark, mein Tempo war beständig, der Magen ok.
Bei einer so langen Distanz ist man auf sehr wenige Dinge reduziert: Laufen, gehen, essen, trinken, schlafen, positives Mindset. Wenn all das erfüllt ist, dann ist die Basis gegeben.

Gegen Mittag erreichte ich die erste größere Station, wo meine Freundin auf mich wartete. Hungrig verschlang ich ein Baguette, dazu ein Protein Pudding. Was für ein Luxus! Die Speicher auffüllen war dringend notwendig, denn der nächste Anstieg über 2.000 Höhenmeter in extremer Hitze wartete.
Die 1,5 Liter Wasser, die ich dabei hatte, waren bei weitem nicht genug. Viele Läufer um mich herum waren so ziemlich am Ende. Die pralle Sonne knallte in den felsdurchsetzten Anstieg – ein langer, zäher Backofen. Ein Brunnen in der Hälfte des Anstiegs fühlte sich an wie eine Oase in der Wüste. Die Höhe machte mir ebenfalls ein wenig zu schaffen, gleich am ersten Tag auf 2.800 Meter hinauf ohne sich vorher zu akklimatisieren war nicht die einfachste Aufgabe, aber irgendwann war auch das geschafft.
Die Belohnung war ein atemberaubender Ausblick, eine Berghütte mitten in den Felsen, wie ich sie in Österreich noch nie gesehen habe. Drei Läufer teilten sich dort gerade frühlich ein Bier. Das schaffen vielleicht Männer, ich wäre im Anschluss wahrscheinlich eingeschlafen oder umgefallen. Außerdem lagen noch 300 Höhenmeter vor mir, bevor es lange und steil Richtung Tal ging. Nach knapp 24 Stunden endete der erste Tag des Swiss Peaks 700, nach etwa 87 Kilometern und 7.000-8.000 Höhenmetern.
Etappe 2 und der Breaking Point
DIe erste Etappe war vorbei, ich war kaputt, aber erleichtert, dort meine Freundin zu sehen. Kurzfristig machte mein Kreislauf schlapp, aber ein Cookie später war die Welt wieder in Ordnung.
Ansonsten galt es, die To-Do Liste nach der ersten Etappe abzuarbeiten: Duschen, sich um die Füße kümmern und möglichst schlafen. Ich teilte mir das Zimmer mit einigen anderen Läuferinnen, der Wecker sollte um 4 Uhr Früh läuten. Das Frühstück am Morgen war alles andere als ausgiebig: Weißbrot, Marmelade, Honig und Löskaffee. Dass mir meine Freundin mit dem Gaskocher eine ‚echte Tasse‘ brachte, zog viele neidische Blicke auf mich.
Um 5 Uhr ging es los. Der Himmel war grau, der Regen würde wohl nicht lange auf sich warten lassen. Die Strecke startete, wie sie am Vortag geendet hatte: steil. Ich hatte zum ersten Mal leichte Magenprobleme, aber kein Wunder nach der Anstrengung am ersten Tag. Dazu war es sehr technisch: Ketten, Leitern, steile und rutschige Felsen. Ich mag technisches Gelände extrem gerne, hatte aber mehr als einen Schutzengel, als ein Felsen mit mind. 20 cm Durchmesser ein paar Meter vor mir zu Boden krachte. Das hätte alles beenden können.
Der Regen machte das Gelände zum Balanceakt. Etliche Läufer hatten Stürze, um genau das zu vermeiden, konnte man nicht mit vollem Risiko laufen. Langsam machte ich mir aber exakt deshalb erstmals Sorgen um das Cutoff. Im Normalfall habe ich damit keine Probleme, aber unzählige Passagen waren ganz einfach nicht laufbar. Dazu kamen durch das extreme Wetter Flussdurchquerungen, weil keine Brücken vorhanden waren. Meine Schuhe waren mit eiskaltem Wasser gefüllt. Nur 90 MInuten vor dem Cutoff (das später aber verlängert wurde, weil auch der Veranstalter den Anspruch unterschätzt hatte) erreichte ich die Labestation. Mir war kalt und ich war müde. Meine Freundin reichte mir wieder Baguette, trotzdem machte ich einen für mich irrsinnig blöden Fehler, Pasta zu essen. Für andere tolle Kohlenhydrate, für meinen Magen manchmal ein Todesstoß… bei Müdigkeit und Hunger funktioniert man nicht immer wie geplant.

Das Wetter wurde nicht besser, es wehte eiskalter Wind, es regnete und regnete. Jetzt folgte ein Grat, den ich auch im Nachhinein als grenzwertig gefährlich empfinde. Wieder extrem steil, matschig, kein Tritt war sicher. Links und rechts ging es steil abwärts. Der Wind blies mir um die Ohren, kein Mensch weit und breit. Undenlich erleichtert erreichte ich den Abstieg, als zwar plötzlich die Sonne hervorkam, ich aber gleichzeitig ein scharfes Stechen in meinem Knie spürte. Was sollte das jetzt? Wie ein Messer. „Das kann nur besser werden“, versuchte ich mich zu beruhigen. Ich war mitten im Nirgendwo in den Schweizer Bergen, zwischen zahlreichen Gipfeln und es folgte ein nächster Anstieg auf knapp 3.000 Meter hinauf. Jeder Schritt schmerzte unendlich. Ich konnte nur noch ein Bein wirklich belasten und entwickelte einfach die Technik, nur mit dem linken Bein aufwärts zu gehen und das rechte Bein wie ein Stück holz hinter mir her zu ziehen. Senkrechte Leitern und Seile machten es nicht einfacher. Meiner Freundin, die im nächsten Tal wartete, sendete ich eine Nachricht.
„Ich bin jetzt wirklich langsam. Schmerzen auf einer Skala von 10: 10.“
Die Entscheidung zu stoppen
Im Downhill fragte ich einen Läufer nach dem anderen, ob vielleicht jemand eine Schmerztablette dabei hatte, um den Abstieg von über 1.000 Höhenmetern irgendwie zu bewältigen. Aber niemand hatte etwas dabei. Im Nachhinein gesehen eine unglaublich dumme Idee, für den Notfall nichts einzupacken. Ich habe noch nie etwas genommen, aber in so einem Extremfall wäre es eine echte Hilfe gewesen. Ich musste den Abstieg ins Tal trotzdem irgendwie schaffen.
Im Abstieg kam ich nach und nach auf eine 8 von 10, ich humpelte den Berg hinunter, völlig unmöglich auch nur einen Meter zu laufen. Bereits jetzt war klar, dass ich eine Chance von maximal 5% hatte, das Rennen weiter zu führen. Aber in dem Moment war mir einfach nur eiskalt, ich zog alles aus meinem Rucksack an, inklusive Regenbekleidung. Einfach nur weitergehen, bloß nicht stoppen, war die Devise.
Nach einer wirklich langen Zeit bei Einbruch der Dunkelheit erreichte ich das nächste Base Camp, kurz vor dem Cutoff. Ein freiwilliger Helfer versuchte mich zu motivieren und mein Knie ein wenig zu stretchen, aber ich hätte wohl zumindest einen Physio gebraucht. Bevor die Zeit abgelaufen war, gab ich mir noch eine letzte Chance: Einfach versuchen, vielleicht würde ich ja doch die Hütte für die Nacht erreichen, die eigentlich nur noch etwa 10 Kilometer und 800 Höhenmeter entfernt war. Dafür hatte ich sogar 3 Stunden Zeit, was in der Regel eine völlig leichte und sogar gehbare Distanz gewesen wäre. Aber es war unmöglich. Mein Knie war geschwollen, der stechende Schmerz war bei jedem Schritt präsent. Es war ganz einfach vorbei.
Ich sendete meiner Freundin eine Nachricht: „Es ist vorbei. Ich komme jetzt zurück.“ Ich wollte nicht mit dem Auto abgeholt werden, sondern alleine zurück gehen. Wie konnte der Traum, den ich ein ganzes Jahr lange hatte, so schnell zu Ende sein? Ich ging im Base Camp duschen, kroch in meinen Schlafsack und konnte all die Emotionen gar nicht einordnen.
Der nächste Tag fühlte sich völlig surreal an. Das größte Ziel war einfach passé. Ich hatte das ganze Jahr keinen Urlaub genommen, ich hatte mich tagtäglich auf dieses Rennen vorbereitete, war vermutlich in der Form meines Lebens und dann war es einfach vorbei. Ich hatte keine Lust zu reden, ich musste das erst einmal begreifen.

Nach vorne blicken
Ein paar Tage später änderte sich meine Perspektive ein wenig. Die Vorbereitung war eben nicht perfekt gewesen. Job, Kinder, viele andere private Dinge, mir hatte ganz einfach die Balance gefehlt. Für ein Rennen wie dieses ist 9 von 10 eben nicht genug. Dazu braucht es eine 10 von 10.
Ich versuchte es als Teil meiner Reise zu akzeptieren. Das nächste Mal würde ich mich beser vorbereiten, besser regenerieren, mehr schlafen und ganzheitlicher trainieren. Aber versuchen werde ich es ganz sicher wieder.
Dennoch fühlte ich mich irgendwie beschämt. Ich hatte das ganze Jahr über mein Training dokumentiert, meine Ziele auf Instagram breitgetreten und nun war nich nach 150 Kilometern ausgestiegen. Am liebsten hätte ich meine Social Media Kanäle gelöscht.
Doch was wäre das für eine Message gewesen?
Fehler gehören zum Leben. Man geht Risiken ein, manchmal verliert man dabei. Was zählt ist, es zu versuchen.
Ich wollte vor allem zeigen, dass es sich lohnt, auf ein Ziel hin zu arbeiten. Ein Rennen, ein Projekt, ein Datum im Kalender – manchmal braucht man etwas, worauf man sich fokussieren kann. Ein Ziel, von dem man in guten und auch schlechten Zeiten getragen wird, egal was sonst im Leben passiert. Mir hat es durch ein sehr zähes Jahr geholfen und ich bereue gar nichts davon, auch wenn ich es nicht ins Ziel geschafft habe.
Ich werde es wieder probieren und wieder zeigen, dass es sich lohnt, aufzustehen, dabei zu lernen und nie aufzugeben.
Was ich beim nächsten Mal anders mache
Wie erwähnt bin ich davon überzeugt, in der Form meines Lebens gewesen zu sein. Jeder Uphill im Training fühlte sich unglaublich einfach an, das Training war gut verlaufen. Aber Training ist eben nicht alles. Regeneration zählt genauso und um ehrlich zu sein hatte ich sehr oft viel zu wenig geschlafen und eben gar nicht auf Erholung geachtet.
Auch Stretchnign hatte ich vernachlässigt, genauso wie regelmäßiges Krafttraining. Für ein Rennen wie dieses muss der ganze Körper absolut stark sein. Barfußläufe, Faszienrolle, mehr Ausgleichssportarten, all das gehört dazu, wenn man Großes erreichen will – egal ob man gerade Lust hat oder nicht.
Fünf Dinge, die ich aus meinem DNF gelernt habe
1. Vorbereitung muss perfekt sein. Für ein so langes Rennen zählt jedes Detail. Training alleine ist nicht genug. Krafftraining, Stretching, Regeneration gehört alles zum Plan.
2. Der Wert eines Ziels Es ist ein unglaublich schönes Gefühl, ein Ziel zu haben, darauf hin zu arbeiten und letztendlcih an der Startlinie zu stehen. In der kleinen Ultralauf Familie muss man sich nicht erklären.
3. Hilfe und Support akzeptieren In der Vergangenheit habe ich fast alle Rennen aleine absolviert. Ich dachte ich würde das auch diesmal schaffen. Im Endeffekt war es aber ein riesengroßer Vorteil, meine Freundin an meiner Seite zu wissen. Supporter sind Teil der ganzen Rennfamilie und in Krisen und harten Zeiten macht das einen riesengroßen Unterschied.
4. Auf den Körper hören. Manchmal sagt der Körper nein. Auch Profis müssen manchmal stoppen. Wer noch viele Jahre laufen möchte und große Projekte verwirklichen möchte, muss manchmal ein Nein akzeptieren.
5. Enttäuschung ist normal, aber temporär. Wer Großes vorhat, darf enttäuscht sein. Alles andere wäre nicht normal. Das darf man zulassen, aber nach einer Weile ist es Zeit, weiter zu gehen, daraus zu lernen, sich zu verbessern und es wieder zu versuchen.
Fazit
Das Swiss Peaks 700 Rennen ist nicht verlaufen, wie ich es mir gewünscht hatte, aber meine Reise hat es sicher nicht gestoppt. Nicht nur Swiss Peaks, sondern auch andere lange Rennen warten noch auf mich. Fehler sind normal, aber nicht final. Ich versuche es als Feedback zu sehen.
Wenn du deine Träume verfolgst, mach weiter. Setz dir ambitionierte Ziele, hör nicht auf die ganzen Nein-Sager, sei mutig genug, es wieder und wieder zu versuchen.
Wenn du auf der Suche nach Beratung oder einem Coach bist, melde dich gerne bei mir.
Text: Sigrid Eder
Fotos: Karin Eibenberger